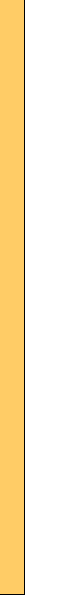
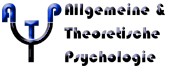
Startseite > Lehre und Prüfungen > VD: alte DPO
Vordiplom-Prüfung: Allgemeine Psychologie I/II
Allgemeines
Lernziel ist der Erwerb eines möglichst breiten Wissens aus den verschiedenen Teilgebieten der Allgemeinen Psychologie. Zentrale Begriffe und Theorien sollten verfügbar sein. Detaillierte Schilderungen einzelner Experimente sind nicht in Kleindetails erforderlich, wichtige Versuche sollten hinsichtlich Hypothesen und Ergebnissen bekannt sein. Vorausgesetzt wird jeweils der Besuch der Vorlesungen "Allgemeine Psychologie I und II" und die Kenntnis ihrer Inhalte. Ein Spezialgebiet kann nicht gewählt werden, wohl aber ein "Einstiegsgebiet" zu Beginn der Prüfung, um die eventuell vorhandene Nervosität zu mindern. Als Einstiegsgebiet kann jedes der weiter unten aufgeführten Teilaspekte (z.B. "Leistungsmotivation", "Raumwahrnehmung") gewählt werden. Vorherige Absprachen dazu sind nicht erforderlich. Jedes der zwei Doppelgebiete eines Prüfungsfachs wird ca. 15 Minuten geprüft (d.h. 30 Minuten pro Prüfungsfach). - Bei kurzfristigen Prüfungsrücktritten bitte telefonisch Bescheid geben (Tel. 54-7388).
Hinweis für Personen, die bereits eine Orientierungsprüfung (OP) in Allgemeiner Psychologie abgelegt haben:
2+2-Modell: Wenn Sie nach *alter* DPO im Vordiplom geprüft werden wollen, gelten die hier gezeigten Infos. Ihre OP wird als Prüfung in Allgemeiner Psychologie I gewertet, hat aber das gesamte Spektrum der AP I + II umfasst. Daher wird die mündliche Prüfung in AP II in diesem Fall aus einer Kombination von vier der acht Teilgebiete (1) Wahrnehmung, (2) Psychomotorik, (3) Gedächtnis, (4) Lernen, (5) Motivation, (6) Emotion, (7) Denken und (8) Entscheiden bestehen. Dabei müssen zwei der vier Teilgebiete aus den Bereichen (1)-(4) stammen, die beiden restlichen aus den Gebieten (5)-(8). Die Prüfung dauert 30 Minuten.
Wer innerhalb der Regelstudienzeit (also bis Ende 4. Semester) seine Prüfungen ablegt, kann auf eines der vier Teilgebiete verzichten (also 1+2 oder 2+1 anstatt 2+2).
AP I: Wahrnehmung und Psychomotorik, Gedächtnis und Lernen
- Wahrnehmung:
- Schwellen; Signalentdeckungstheorie;
Psychophysik (Weber, Fechner, Stevens);
visuelles System (Aufbau des Auges; Reizleitung);
Konstanzleistungen (Größe, Farbe, Helligkeit, Form;
Mondtäuschung);
Farbwahrnehmung (Farbkreis, additives und subtraktives Mischen,
Theorien);
Raumwahrnehmung (mon- und binokulare Signale);
Form- und Figurwahrnehmung (Gestaltprinzipien;
Wahrnehmungstäuschungen);
Aufmerksamkeit.
- Coren, S., Ward, L.M. & Enns, J.T. (1999). Sensation and perception (5th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers.
- Psychomotorik:
- Periphere Mechanismen der Bewegungssteuerung;
Regelung und Programmsteuerung; Koordination von Bewegungen;
Wahrnehmung und Bewegung; Repräsentation von Bewegungen;
Bewegung und Vorstellung.
- Heuer, H. (1990). Psychomotorik. In H. Spada (Ed.), Lehrbuch Allgemeine Psychologie (pp. 495-559). Bern: Huber.
- Gedächtnis:
- Meß- und Testmethoden der Gedächtnispsychologie
(Reproduktion und Wiedererkennen; recognition failure;
direkte und indirekte Verfahren); Sensorisches Gedächtnis
(ikonisches und Echo-Gedächtnis; Maskierung);
Kurzzeitgedächtnis (Gedächtnisspanne,
Brown-Peterson-Paradigma,
proaktive und retroaktive Hemmung; Argumente für und gegen
Mehrspeicherkonzeption; Atkinson-Shiffrin-Modell; Arbeitsgedächtnis nach Baddeley);
Imagery (mentale Rotation, Duale Kodierung);
Übungseffekte (total-time-Hypothese;
verteilte vs. massierte Übung; expanding-rehearsal-Strategie);
Ansatz der Verarbeitungstiefe (Arten von Rehearsal;
Probleme des LOP-Ansatzes; transferangemessene Verarbeitung);
Organisationseffekte (semantisch, subjektiv, imagery; mnemonics);
Vergessen (Vergessenskurve für KVK-Listen, Namen, Gesichter,
Sprache, Fertigkeiten; Vergessenstheorien;
pro- und retroaktive Interferenz);
Abruf (Verfügbarkeit vs. Zugänglichkeit, retrieval cues,
Kontext- und Zustandsabhängigkeit; seriell exhaustive Suche;
Enkodierspezifität); Wissen und semantisches Gedächtnis
(Netzwerkmodelle, Collins & Quillian, Merkmalsvergleichsmodell;
Bartletts Schemabegriff und moderne Schemakonzeptionen).
- Baddeley, A. (1990). Human memory. Theory and practice. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. [Kap. 2-5, 7, 8, 10, 11, 13]
- Lernen:
- Klassische Konditionierung (Paradigma; Kontiguität vs.
Kontingenz, Theorie von Rescorla; Konditionierung höherer Ordnung;
konditionierte emotionale Reaktion; biologisch vorbereitetes Lernen);
operante Konditionierung (Paradigma, Systematik nach Grant;
Verstärkung vs. Bestrafung; Verhaltensketten;
Zweifaktoren-Theorie von Skinner; Biofeedback; Abergläubisches
Verhalten; Shaping und Autoshaping); Beobachtungslernen (Paradigma,
Bedingungen, Experimente, Menschenbild; latentes Lernen);
Merkmals- und Regelidentifikation (Paradigmen, Strategien);
Diskriminationslernen (Transposition, Gradienten, Umkehrlernen).
- Bredenkamp, J. & Wippich, W. (1977). Lern- und
Gedächtnispsychologie.
Band 1. Stuttgart: Kohlhammer. [Kapitel 2 - 6]
- Halisch, F. (1990). Beobachtungslernen und die Wirkung von Vorbildern.
In H. Spada (Ed.), Lehrbuch Allgemeine Psychologie (pp. 373-402).
Bern: Huber.
- Spada, H., Ernst, A.M. & Ketterer, W. (1990). Klassische und operante Konditionierung. In H. Spada (Ed.), Lehrbuch Allgemeine Psychologie (pp. 323-372). Bern: Huber.
- Bredenkamp, J. & Wippich, W. (1977). Lern- und
Gedächtnispsychologie.
Band 1. Stuttgart: Kohlhammer. [Kapitel 2 - 6]
AP II: Motivation und Emotion, Denken und Entscheiden
- Motivation:
- Grundlegende Begriffe; Ansätze (Instinkttheorie,
Psychoanalyse, Biopsychologie, Kognitive Ansätze,
Willens- und Handlungstheorien); Triebreduktionstheorien
(FREUD; HULL); Attributionstheorie (Kausalattribution von
Leistungen);
Grundlegende Motive (Hunger, Durst, Sexualität, Neugier);
Aggression und Frustration;
Macht- und Anschlußmotivation; Leistungsmotivation.
- Schneider, K. & Schmalt, H.-D. (2000). Motivation. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Weiner, B. (1984). Motivationspsychologie. Weinheim: Beltz. [Kap. 2: Die psychoanalytische Theorie der Motivation; Kap. 3: Die Hullsche Triebtheorie; Kap. 5: Die Theorie der Leistungsmotivation; Kap. 8: Eine attributionale Theorie des Verhaltens]
- Emotion:
- Reaktionstrias und Arbeitsdefinition;
Theorien der Emotion (klassisch-behavioristisch: Watson;
kognitiv-physiologisch: James-Lange, Cannon, Marañon,
Schachter & Singer, Valins, Mandler; attributional: Weiner);
Gesichtsausdruck von Emotionen.
- Meyer, W.-U., Schützwohl, A. & Reisenzein, R. (1993).
Einführung in die Emotionspsychologie. Band I.
Bern: Hans Huber.
- Schneider, K. (1990). Emotionen. In H. Spada (Ed.), Lehrbuch Allgemeine Psychologie (pp. 403-449). Bern: Huber.
- Meyer, W.-U., Schützwohl, A. & Reisenzein, R. (1993).
Einführung in die Emotionspsychologie. Band I.
Bern: Hans Huber.
- Denken:
- Gegenstand der Denkpsychologie;
Methodenprobleme (Introspektion, verbale Daten, Computersimulation);
Deduktives Schließen (Syllogismen; Wason Selection Task;
typische Fehler); Induktives Schließen (Heuristiken;
pragmatisches Schlußfolgern);
Klassisches Problemlösen (Gestalttheorie, Assoziationismus,
Informationsverarbeitungstheorie; Klassifikation von Problemen);
Komplexes Problemlösen (Dörner-Ansatz, zentrale Befunde,
Zusammenhang zur Intelligenz; Kritik);
Kreativität (Konzeptionen; Meßverfahren).
- Dörner, D. (1976). Problemlösen als
Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hussy, W. (1984). Denkpsychologie. Ein Lehrbuch. Band 1.
Stuttgart: Kohlhammer. [Kap. 1: Einführung;
Kap. 2: Historischer Abriß;
Kap. 4: Problemlösen]
- Hussy, W. (1986). Denkpsychologie. Ein Lehrbuch. Band 2. Stuttgart: Kohlhammer. [Kap. 1: Schlußfolgern, Urteilen und Kreativität]
- Dörner, D. (1976). Problemlösen als
Informationsverarbeitung. Stuttgart: Kohlhammer.
- Entscheiden:
- Normative und deskriptive Nutzen- und Entscheidungstheorien (z.B. Prospekt-Theorie);
quantitative Urteile (Linsenmodell).
- Baron, J. (1988). Thinking and deciding. Cambridge: Cambridge University Press. [Kap. 16, 17, 18]
zu den Skripten
Zuletzt bearbeitet am 14.11.2003 von JF. |