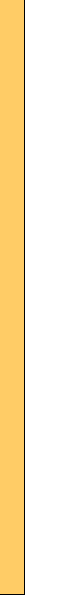
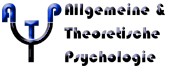
Personen > Joachim Funke > Öffentliche Prüfungen
Einige Bemerkungen zum Thema 'öffentliche Prüfungen'
Joachim Funke & Klaus-Martin Klein
Erste Version 10/1995; aktualisiert: 10/1997
Aus den Erfahrungen einer ganzen Reihe von Prüfungsperioden heraus möchten wir im folgenden einige Bemerkungen zum Thema Öffentliche Prüfungen machen, die für Studierende, Prüfende und Zuhörende gleichermaßen interessant sein könnten.
Vorbemerkungen
Prinzipiell begrüßen wir es sehr, wenn eine Prüfungsordnung öffentliche Prüfungen zuläßt. Öffentliche Prüfungen stellen ein hervorragendes Instrument dar, um kommenden Prüfungskandidatinnen und -kandidaten bestimmte Aspekte der meist noch relativ unbekannten Situation "Prüfung" transparent zu machen; hierzu können Aspekte wie Atmosphäre, Prüfungsstil, Art der Fragestellung, Abdeckung von Prüfungsstoff, Umgang des Prüfers mit den Kandidatinnen und Kandidaten etc. gehören. Wir sind der Ansicht, daß es nicht genug öffentliche Prüfungen geben kann.Weiterhin gehen wir davon aus, daß Konsens darüber herrscht, daß ein sozialintegrativer Prüfungsstil (geringe Häufigkeit der Ausdrucksformen von Macht und hierarchischer Überlegenheit, Achtung der Gleichwertigkeit und Würde des Anderen, Berücksichtigung des Denkens und Fühlens des Anderen etc.) sich am effektivsten auf die Prüfungsatmosphäre wie auch auf die in der Prüfung erzielte Leistung auswirkt. Wir haben als Prüfer/Beisitzer sicher nicht die Voreinstellung, daß es sich bei den Prüflingen um "Leistungserschleicher" handelt. Wenn allerdings ein derartiger Fall eintritt, halten wir eine harte Reaktion für angemessen. Jedoch ist es nicht einfach, objektivierbare Indikatoren hierfür zu finden, denn gelegentlich führen "black outs" oder Prüfungsstreß selbst bei gut vorbereiteten Prüflingen zu Leistungsminderungen oder gar -ausfällen. Wir hoffen, daß die hier dargestellte Diskussion nicht dazu mißbraucht wird, um Öffentlichkeit in Zukunft zu verhindern oder die Kritik an den Mängeln des eigenen Prüfungsverfahrens durch ein Aufgreifen dieser Diskussion zunichte zu machen.
Die folgenden Punkte erscheinen uns jedoch mitteilenswert, wobei wir drei verschiedene Perspektiven zu diesem Thema unterscheiden möchten: die Sicht der Prüflinge, die der Zuhörenden und last not least die der Prüfenden. Neben allgemeinen Bemerkungen wollen wir jeweils konkrete Empfehlungen in Form von Tips geben und damit zu einer breiteren Diskussion auffordern.
1. Prüflingsperspektive
Wann sollte eine Kandidatin oder ein Kandidat eine Prüfung zu einer öffentlichen Prüfung machen, wieviele Zuhörer sollte er zulassen? Erfahrungsgemäß ist es selbstsicheren und "sattelfesten" Prüflingen ziemlich egal, ob ein oder mehrere Mitstudentinnen und/oder Mitstudenten an einer Prüfung teilnehmen, der Fachliteratur zufolge sind hier sogar positive Effekte beobachtbar (vgl. Prahl, 1979). Bei unsicheren bzw. prüfungsängstlichen Kandidaten können dagegen vor allem mehrere Zuhörer fatale Auswirkungen haben: zum einen deshalb, weil Zuhörer immer für eine gewisse Unruhe sorgen, die ablenkend wirkt. Zum anderen können z.B. ohnehin vorhandene negative selbstwertbezogene Prozesse (Selbstzweifel oder Aufgeregtheit) möglicherweise noch verstärkt werden ("Was denken die jetzt von mir?", "Gleich wissen alle, daß ich ein Versager bin!" ...). Dies geschieht unseren Beobachtungen nach vor allem am Anfang, seltener am Ende der Prüfung, und ist insofern umso ärgerlicher, wenn man hier die Chance verspielt, über sein Einstiegsthema die Prüfungssituation mit-zugestalten.
Tips: Ist man unmittelbar vor der Prüfung unsicherer als eigentlich
erwartet, sollte man noch vor Beginn der Prüfung seine Unsicherheit
thematisieren und nur einen (oder auch gar keinen) Zuhörer zulassen. Es
erwartet keiner, daß freiwillige Verpflichtungen ("Ich habe die
Prüfung als öffentlich angekündigt, jetzt muß ich mich auch
daran halten") dieser Art, die ja zumeist aus altruistischen Motiven heraus
eingegangen werden, auch gegen die eigenen Bedürfnisse eingehalten werden.
Sollen dennoch Zuhörer zugelassen werden, dann sollten es vertraute Personen sein: der (zu diesem Thema nur spärlich vorhandenen) Literatur zufolge wirkt die Anwesenheit vertrauter Personen auf den Prüfling beruhigend bzw. läßt keine zusätzliche Angst entstehen (vgl. Prahl, 1979).
2. Öffentliche Prüfungen aus der Perspektive der Zuhörenden
Global kann man zunächst einmal nicht davon ausgehen, daß die
Teilnahme an Prüfungen für die Zuhörenden von vorneherein
unproblematisch ist. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:
a) Es werden (möglicherweise) Einstellungseffekte erzeugt: "dies
war in der Prüfung gefragt worden, also wird es auch in meiner Prüfung
gefragt werden." Wir konnten dieses Phänomen mehrfach beobachten:
Themen, die als Prüfungsthemen bekanntgemacht, in vorausgegangenen
Prüfungsperioden jedoch kaum behandelt worden waren, wurden nicht
vorbereitet. Man hatte sich offensichtlich darauf verlassen, daß zu diesem
Thema keine Fragen gestellt werden.
b) Die Leistungsqualität der Prüflinge kann vor allem auf
ängstliche Zuhörer angststeigernd statt angstreduzierend wirken. Dies
geschieht vor allem dann, wenn es sich um (gute oder schlechte) Extremleistungen
handelt. So kann die Unsicherheit eines Zuhörers noch dadurch verstärkt
werden, daß er Zeuge einer "Glanzleistung" geworden ist und sich
selbst dann in Relation zum Prüfling unterlegen fühlt (im Sinne von
"so eine Leistung schaffe ich ja nie", "da habe ich doch
überhaupt keine Chance" usw.).
Tips: Auch hier wirkt sich eine Bekanntschaft mit dem Kandidaten positiv aus, da man dadurch dessen Leistungen auch in Bezug auf andere relativieren kann. Sicher hilft auch eine vorherige Auseinandersetzung mit dem Themengebiet (z.B. anhand der Stichwortlisten), Unsicherheiten zu reduzieren: hinter einem kompliziert klingenden Fachbegriff (z.B. Enkodierungsspezifität) verbirgt sich nicht selten eine relativ einfache Konzeption.
3. Öffentliche Prüfungen aus Sicht der Prüfenden
Dieser Punkt verdient fast nur aus formalen Gründen Erwähnung: Prüfende sollten sich dadurch, daß Prüfungen öffentlich sind, eigentlich nicht oder kaum gestört fühlen. Dennoch ist natürlich bei einer größeren Zuhörerzahl nicht auszuschließen, daß die Konzentration des Prüfenden gestört wird - nicht ganz ausschließen darf man sicher die Möglichkeit, daß Prüfende diese öffentliche Situation (Motto: "Now I am on stage...") zu einer Demonstration ihrer Prüfungskompetenz mißbrauchen könnten.
Literatur
- Krumpholz, D. (1993). Kognitionen von Studierenden während einer mündlichen Prüfung in Abhängigkeit von Prüfungsängstlichkeit, Geschlecht und Studienfach. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 14, 177-188.
- Prahl, H.-W. (1979). Prüfungsangst: Symptome - Formen - Ursachen. Frankfurt am Main: Fischer.
- Wolf, D., & Merkle, R. (1997). So überwinden Sie Prüfungsängste (5. Aufl.). Mannheim: PAL Verlag.
Weitere Info: auf dem Prüfungsvideo gibt es eine Passage zu diesem Thema.
Zuletzt bearbeitet am 26.11.2001 von JF. |