|
7.4
Objekterkennung und Klassifikation
Die
Vorstellung, die der Objekterkenntung grundsätzlich zugrunde
liegt, ist die folgende: Zunächst entdeckt man einfache Merkmale
(1), die man in einem zweiten Schritt zu einem perzeptuellen Objekt
zusammen fügt (2). Dieses perzeptuelle Objekt wird identifiziert,
indem es mit denen im Gedächtnis gespeicherten Objekten verglichen
wird (3). Man unterscheidet verschiedene Verarbeitungsformen.
Wiedererkennung
vs. Identifikation
Die
Wiedererkennung ist leichter als die Identifikation oder Klassifikation.
Wiedererkennung
findet schon dann statt, wenn der Eindruck von Familiarität
vorliegt: Man nimmt etwas wahr, was man schon einmal gesehen hat
(z.B. eine Person, die man aber nicht zuordnen kann).
Objekt-Identifikation
bedeutet, dass das Objekts benannt wird. Hierzu ist eine korrekte
Klassifikation notwendig: der Kontext und die Beziehungen zu anderen
Konzepten müssen erkannt werden (z.B. eine Person, die man
gut kennt, deren Namen man weiß).
Daten-
vs. konzeptgesteuerte Verarbeitung
Datengesteuert
(“bottom-up”): die datengesteuerte Verarbeitung beginnt
auf der Rezeptorebene und die Daten rufen Regeln auf. Wäre
dies die einzige uns zur Verfügung stehende Art der Verarbeitung,
dann könnten wir keinen Gebrauch von unserem Erfahrungsschatz
machen.
Konzeptgesteuert
(“top-down”): bei der konzeptgesteuerten Verarbeitung
lenken vorherige Erfahrungen eine aktive Suche nach bestimmten Mustern
im Wahrnehmungsgegenstand. Würden wir aber ausschließlich
auf diese Weise verarbeiten, dann sähen wir nur das, was wir
erwarten.
Die
folgende Abbildung zeigt Hinweise auf datengesteuerte Prozesse.
Sie stammen aus Untersuchungen mit stabilisierten Retina-Bildern:
Hier kann man feststellen, dass das Verschwinden feature-weise erfolgt,
d.h. es verschwinden jeweils ganze Linien udn Winkel (obere Abbildung).
Bei zufälligem Verschwinden könnte das Bild so aussehen,
wie in der unteren Abbildung.
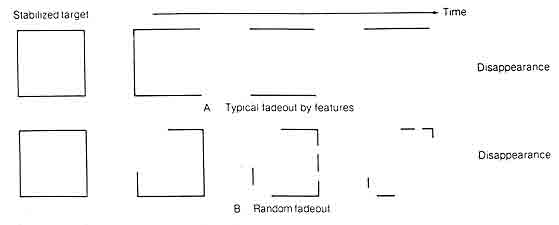
Globale
vs. lokale Verarbeitung
Navon
(1977) stellte fest, dass globale Merkmale schneller entdeckt
werden als Detailmerkmale (lokale Merkmale).
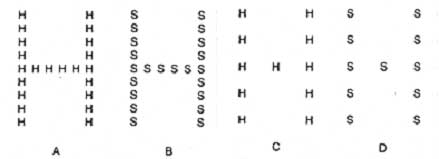
Das
heißt, dass das große H schneller entdeckt wird als
das kleine H (Abbildung A). Darüber hinaus konnte er feststellen,
dass das Benennen der lokalen Form stark verlangsamt ist, wenn die
globale Form (H) von der lokalen Form (S) abweicht (Abbildung B
im Vergleich zu A). Wird allerdings die globale Formwahrnehmung
erschwert (bei Wechsel von A und B nach C und D), kehrt sich der
Effekt um!
Integrale
vs. separable Stimuli
Die
Unterscheidung zwischen integralen und separablen Stimuli wirft
erneut die Frage auf, was eigentlich “gute” Figuren auszeichnet?
Einigen wir uns mit Lockhead (1966) und Garner (1978) darauf, dass
es so etwas ist wie eine "eigentümliche Ganzheit"
und das "nicht einfache Aufbrechen-Können in einzelne
Komponenten".
Integral:
Integral sind dann solche Stimuli, die ganzheitlich wahrgenommen
werden. Alle Aspekte des Stimulus werden simultan wahrgenommen.
Separabel:
Separable ist ein Stimulus dann, wenn die Stimulus-Aspekte nicht
einfach integriert werden können. Die unten abgebildeten Punktemuster
kennst Du schon; sie sind ein Beispiel für separable Stimuli.
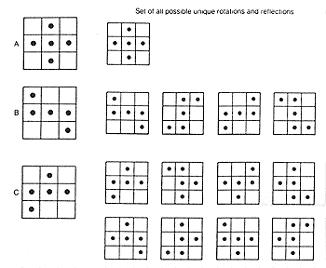
Kontexteffekte
bei der Identifikation
Manchmal
kann man seine eigene Schrift nicht mehr lesen, aber aus dem Zusammenhang
lässt sich oftmals doch erraten, was da wohl stehen muss. Genau
das ist ein "Kontexteffekt bei der Identifikation". Ein
schönes Beispiel für einen konzeptgesteuerten Prozess
ist das folgende Bild.
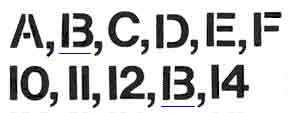
Das
“B” und die “13” sind identisch, werden aber
durch den Kontext anders identifiziert.
Ein
anderes Beispiel stammt von
Palmer (1975): konzeptgesteuerte Erwartungen kompensieren fehlende
Detailtreue, die in einer datengesteuerten Verarbeitung erforderlich
wäre.
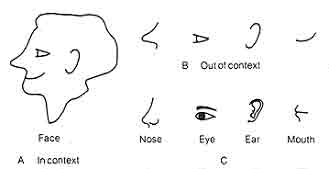
|
