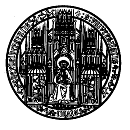|
|
Projekt
"Energiemanagement" der Universität
Heidelberg am Psychologischen Institut |
Am Psychologischen Institut
fand von Juli 2001 bis Dezember 2006 ein Pilotprojekt zum Thema
"Energiesparen in Universitätsgebäuden" statt, das gemeinsam vom
Psychologischen Institut, der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg, der Stadt Heidelberg
(seinerzeit vertreten durch das Agenda-Büro,
seit 2007 durch das Amt für
Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie) sowie von der "Klimaschutz-
und Energieberatungsagentur (KliBA)“
unterstützt und getragen wurde. Sowohl
technische als auch Änderungen im Verhalten der Personen, die das Gebäude
nutzen, wurden durchgeführt; letztere standen jedoch im Vordergrund.
Grundlegend war dabei die Annahme, dass technischer Umweltschutz alleine nicht
ausreichend ist. Die „heiße Phase“ des Projekts ging bis
Ende 2003; bis Ende 2006 fanden noch Nacherhebungen statt, um die
Dauerhaftigkeit der Effekte zu prüfen. Diese Seiten geben einen Überblick über
die Idee, die Grundlagen, die Durchführung und die Ergebnisse des Projekts
sowie einige thematisch interessante Links. Die Präsentation von Daten in
diesem Rahmen wurde 2009 eingestellt; Ergänzungen und Korrekturen werden jedoch
vorgenommen, falls erforderlich. Ab 2009 werden die jährlichen Verbräuche auf
einen neuen Vergleichzeitraum bezogen und nur noch den Mitgliedern des
Psychologischen Instituts im Intranet zur Verfügung gestellt.
Innerhalb des Gesamtprojekts gibt es ein zweites Teilprojekt, das nicht
an einem Institut stattfindet, sondern in einem größeren Gebäude, das sich das
Physikalisch-Chemische Institut, die Angewandte Physikalische Chemie, die
Umweltphysik und die Theoretische Chemie teilen. Das „Gebäude INF
229“ ist ein erst 1999 fertig gestellter und bezogener Neubau, in dem
Laborräume dominieren, wo sehr energieintensive Geräte benutzt werden (z.B.
Laser). Gesetzliche Vorschriften und technische Erfordernisse ziehen einen sehr
hohen Energieaufwand für das Konstanthalten der Raumtemperatur und für die
Lüftung nach sich; neben Strom und Heizenergie (Fernwärme) wird auch Kälte
benötigt. Als weiteres Charakteristikum besteht die Möglichkeit, über eine sehr umfangreiche Infrastruktur
von Energiezählern weitaus detailliertere
Rückmeldungen zum Energieverbrauch zu geben, als dies üblicherweise möglich
ist: Fast jeder Raum und jedes Labor hat eigene Messgeräte, die in Echtzeit per
PC von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgelesen werden können. Am
Psychologischen Institut hingegen hat z.B. jedes Gebäude nur einen Stromzähler,
die Fernwärme wird gar nur für mehrere Gebäude zusammen erfasst, die
Rückmeldung erfolgt nur monatlich. Ziel des Teilprojekt in INF
229 ist es, Erfahrungen mit diesen detaillierten technischen
Rückmeldemöglichkeiten zu sammeln. Können sie in Verbindung mit
Motivationsmaßnahmen zu einem sparsameren Umgang mit Energie führen? Das
Teilprojekt war bis Ende 2004 in der Vorbereitungsphase, startete Anfang 2005 und
ist mittlerweile ebenfalls beendet. Maßgeblich für dieses Teilprojekt war Dr.
Reinhold Bayer vom Institut für
Umweltphysik der Universität Heidelberg.
Weitere Informationen zum Projekt am Psychologischen
Institut finden Sie hier :
Allgemeine Informationen zum Energiesparen
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
|
Kontaktadresse:
Joachim.Schahn@psychologie.uni-heidelberg.de |
Letzte Veränderung auf der
Hauptseite oder einer Unterseite: 16. Juli 2013