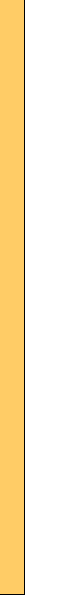
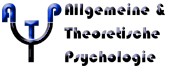
Startseite > Problemlösendes Denken > PLD Links
Problemlösendes Denken - Links

Kapitel 1: Einführung
Zusammenfassung: Was haben wir bisher über problemlösendes Denken gelernt? Zunächst Definitorisches: Problemlösendes Denken ist als Teil menschlicher Handlungsregulation zuständig für Nicht-Routine-Situationen, in denen Hindernisse den Weg zum Ziel versperren und zielführende Aktionen überdacht werden müssen. Im Unterschied zu blindem Versuchs-und-Irrtums-Lernen ist problemlösendes Denken eine wissensgestützte Tätigkeit.
Probleme entstehen, weil Menschen Ziele verfolgen. Die Verknüpfung des problemlösenden Denkens mit Wertentscheidungen ist daher offenkundig. Je abstrakter und unschärfer Ziele ausfallen, desto eher muss man von Optimierung anstatt von Lösungen durch problemlösendes Denken sprechen.
Ein Blick in die neuere Geschichte zeigt uns, dass assoziationistische Vorstellungen (Bildung neuer Ideen und Vorstellungen durch Assoziation bereits vorhandener) neben gestaltpsychologischen (Transformation defekter Gestalten durch Einsicht in gute Gestalten) entwickelt wurden. Radikale behavioristische Traditionen, die aus methodischen Gründen die Beschäftigung mit inneren Vorgängen ablehnten, wurden abgelöst durch kognitive Theorien, in denen gerade die inneren Prozesse („Kognitionen“) zum Gegenstand der Theorienbildung und des experimentellen Hypothesentests gemacht wurden.
Gelernt haben wir auch, dass nicht ein Problem wie das andere ist. Dennoch lässt sich die Vielfalt möglicher Probleme dadurch ordnen, dass wir anhand ihres Lösungsraums offene von geschlossenen Problemen und anhand des jeweils zur Lösung benötigten Wissens wissensarme von wissensintensiven Problemen unterscheiden können. Bei komplexeren Problemen kommen weitere Dimensionen ins Spiel.
Schließlich muss festgehalten werden, dass problemlösendes Denken nicht isoliert betrachtet werden darf. Es ist Teil eines Gesamtsystems psychischer Funktionen, dessen Zusammenspiel letztlich zählt.
Links:
Kapitel 2: Theorien des problemlösenden Denkens
Zusammenfassung: In diesem Kapitel ging es um Theorien des problemlösenden Denkens, um Bezugsrahmen also, die für die konzeptuelle Erfassung des Gegenstandbereichs zur Verfügung stehen. Die großen Linien werden dabei durch folgende Ansätze markiert:
- Assoziationismus/Lerntheorie: Problemlösendes Denken ergibt sich als Umschichtung einer Reaktionshierarchie, deren oberste Reaktion zunächst nicht zielführend ist und daher ein Problem darstellt (siehe Kapitel 2.2).
- Gestalttheorie: Problemlösendes Denken stellt sich als Suche nach der guten Gestalt dar. Ein Problem besteht, wenn eine defekte Gestalt vorliegt (siehe Kapitel 2.3).
- Psychoanalyse: Problemlösendes Denken bedeutet Bewusstmachtung unbewusster Inhalte, Denken wird als Probehandeln betrachtet (siehe Kapitel 2.4).
- Funktionalismus/Informationsverarbeitung: Problemlösendes Denken sucht nach Operatoren, die das Problem in Form einer Lücke zwischen Ist- und Soll-Zustand möglichst effizient überbrücken. Problemraum und Operatoren werden formal präzise beschrieben (siehe Kapitel 2.5). Für die formalen Ansätze der kognitiven Modellierung stehen Produktionssysteme und konnektionistische Modelle zur Verfügung (siehe Kapitel 2.6).
- Handlungstheorie: Problemlösendes Denken ist Teil einer umfassenderen Handlungsregulation, die darauf bedacht ist, bestimmte Intentionen bzw. Absichten einer Person möglichst erfolgreich zu realisieren. Probleme stellen Hindernisse in phasenhaft modelliertem Handlungsablauf dar, die durch Denken überwunden werden können (siehe Kapitel 2.7).
- Evolutionspsychologie: Problemlösendes Denken erfolgt unter Einsatz von Heuristiken, die sich in der Evolution bewährt haben und in vielen Fällen (aber eben nicht immer) zum Erfolg führen. Je nach Problemtyp werden unterschiedliche Heuristiken aktiviert, die in hohem Maße von Kontextfaktoren beeinflusst werden (siehe Kapitel 2.8).
Wie sich aus dieser zusammenfassenden Übersicht ergibt, sind die Grenzen zwischen den verschiedenen Ansätzen nicht immer scharf gezogen. Teilweise sind es die hinter den Ansätzen stehenden Menschenbilder, die ansonsten ähnliche Grundannahmen differenzieren wie z.B. im Vergleich von Funktionalismus und Handlungstheorie (siehe hierzu auch Herrmann, 1982). Spricht der Informationsverarbeitungsansatz etwa von Sollwert-Abweichungen, die es zu beheben gilt, wird eine mechanistische Annahme getroffen. Spricht die Handlungstheorie von Intentionen, die (noch) nicht erreicht sind, wird eine humanistische Annahme getroffen, in der auch Bedeutungen eine Rolle spielen - die Parallelen wie auch Unterschiede zwischen der Sollwert-Abweichung in einem Heizungssystem und der Intention, wegen der frischen Abendluft eine Jacke anziehen zu wollen, sind unübersehbar.
Ohne eine der vorgestellten Theorien besonders herauszustellen, soll am Ende dieses Kapitels festgehalten werden, dass mit ihnen verschiedene Sichtweisen auf den Bereich des problemlösenden Denkens vorliegen, die spezifische Stärken und Schwächen haben. Je allgemeiner diese Rahmenvorstellungen ausfallen, umso eher entziehen sie sich der empirischen oder gar experimentellen Prüfung. Dennoch helfen sie, die vielfältigen Einzelstudien, mit denen uns die psychologische Forschung konfrontiert, in einem allgemeinen Rahmen zu fassen.
Links:
Kapitel 3: Paradigmen und Befunde zum Lösen einfacher Probleme
Zusammenfassung: Forschung zum einfachen Problemlösen bedient sich so unterschiedlicher Problemstellungen wie den KRYPTARITHMETISCHEN PROBLEMEN, dem TURM VON HANOI, KANNIBALEN UND MISSIONAREN, oder den EINSICHTSPROBLEMEN (siehe Kapitel 3.1). Am Beispiel der UMSCHÜTTAUFGABEN konnten Einstellungseffekte demonstriert werden, bei denen sich schon nach wenigen Schritten eine Routine-Lösung ergibt, die später nicht mehr optimal ist, aber dennoch beibehalten wird (Kapitel 3.2). Forschung zum einfachen Problemlösen hat auf die Rolle der Repräsentation hingewiesen und damit den Zusammenhang zur Gedächtnispsychologie hergestellt (Kapitel 3.3). Je nach Abstraktionsstufe stehen andere Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. In aller Kürze sind in Kapitel 3.4 robuste Befunde zum einfachen Problemlösen vorgestellt worden, die Übungseffekte, Transfer sowie Experten-Novizen-Unterschiede betreffen. Hierzu liegen zahlreiche Studien aus den genannten Bereichen vor, auf die sich die Forschung stützen kann. Kapitel 3.5 schließlich hat einen kleinen Einblick in die Erhebungs- wie Auswertungs-Methoden der Problemlöseforschung geliefert, die auf Verhaltensdaten, subjektive Angaben, Fallbeispiele und Tierversuche zurückgreifen kann.
Links:
Kapitel 4: Das Lösen komplexer Probleme: Grundlegende Ideen
Zusammenfassung: Dieses Kapitel behandelt Paradigmen und Befunde zum Lösen komplexer Probleme. Deren zentrale Eigenschaften, die sich deutlich von denjenigen einfacher Probleme abheben, lassen sich auf die systeminhärenten Merkmale Vernetztheit und Dynamik sowie auf die untersuchungsabhängig variierbaren Merkmale Intransparenz und Polytelie kondensieren (siehe Kapitel 4.1).
Ein Blick in die Geschichte dieses jungen Forschungszweigs zeigt in Europa zwei unterschiedliche Zugänge zum Komplexen Problemlösen: einmal die differentialpsychologisch motivierte Suche nach interindividuellen Unterschieden, zum anderen die allgemeinpsychologisch motivierte Suche nach wichtigen Eigenschaften dynamischer Systeme und deren Auswirkungen auf den Problemlöseprozess. Beide Zugänge ergänzen einander (siehe Kapitel 4.2).
Die zum Erkenntnisgewinn notwendige Methodik ist durchaus kontrovers diskutiert worden in der Auseinandersetzung um kondensierendes bzw. dissoziierendes Vorgehen: Während die Kondensation eine Vereinfachung unter Beibehaltung wichtiger Komponenten bedeutet („holzschnittartiges Abbild“), ist das dissoziierende Vorgehen analytisch und richtet sich auf Details unter Vernachlässigung des Ganzen. Eng damit verbunden ist die Frage, ob das Lösen komplexer Probleme experimentell untersuchbar sei. Die Quintessenz dieser Debatte läuft auf einen liberalen Standpunkt hinaus, der Erkenntnis aus möglichst vielen Quellen schöpft (siehe Kapitel 4.3).
Links:
Kapitel 5: Das Lösen komplexer Probleme: Paradigmen und Befunde
Zusammenfassung: Dargestellt wurde in diesem Kapitel die Vielfalt der Untersuchungsparadigmen, zu denen realitätsnahe Szenarios wie LOHHAUSEN oder TAILORSHOP (siehe Kapitel 5.1) und Szenarios auf der Basis formaler Modelle wie Strukturgleichungsmodelle oder finite Automaten gehören (siehe Kapitel 5.2). Die mit den verschiedenen Paradigmen ermittelten Befunde lassen sich danach unterteilen, ob sie schwerpunktmäßig Personmerkmale, Situationsmerkmale oder Systemmerkmale untersuchen.
- Zu den Personmerkmalen zählen etwa Intelligenz, Übung und Expertise; aber auch spezielle klinische Gruppen oder unterschiedlich erfolgreiche Strategien gehören zu den erforschten Themen (siehe Kapitel 0).
- Zu den Situationsmerkmalen zählen Faktoren wie die Art der Aufgabenstellung, Stress, Transparenz, Einzel- oder Gruppenarbeit oder die Art der Informationsdarbietung (siehe Kapitel 5.4).
- Zu den Systemmerkmalen zählen Aspekte wie Eigendynamik, zeitverzögerte Rückmeldungen oder semantische Einkleidung eines Systems (siehe Kapitel 5.5).
- Schließlich wird über Studien berichtet, die eine Interaktion der genannten Einflussbereiche untersucht haben (siehe Kapitel 5.6).
Links:
Kapitel 6: Problemlösendes Denken aus Sicht verschiedener Teildisziplinen
Zusammenfassung: Der Streifzug durch die verschiedenen psychologischen Teilgebiete macht die jeweilige Bedeutung problemlösenden Denkens für diese Bereiche deutlich. In den Grundlagendisziplinen Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und Differentielle Psychologie sind jeweils eigenständige Bereiche ausfindig zu machen, die von der Perspektive des Komplexen Problemlösens profitieren und durch das Aufgreifen dieser Thematik neue Erkenntnisse gewinnen. Aber auch in den drei herausgegriffenen Anwendungsfeldern Pädagogische Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Klinische Psychologie hat das Komplexe Problemlösen deutliche Spuren hinterlassen, die sich in einer Reihe interessanter Arbeiten dokumentieren lassen. Schließlich zeigt die Perspektive des Kulturvergleichs die Notwendigkeit, die kulturelle Bedingtheit von Problemlöseprozessen stärker zu berücksichtigen. In einer zunehmend multikulturellen Umgebung mit allen daraus resultierenden Vor- und Nachteilen muss dieser Thematik mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden als bisher.
Links:
Kapitel 7: Ausblick
Zusammenfassung: Diskutiert werden abschliessend wichtige Zukunftsfragen: (1) Welche Bedeutung kommt den Ergebnissen bildgebender Verfahren zu? (2) Wann kommen längsschnittliche Untersuchungen zum Problemlösen? (3) Wie stark fallen Kontext- und Kultureffekte aus? (4) Ist Problemlösen eine domänenübergreifende Kapazität oder doch eine bereichsspezifische Fähigkeit? (5) Wie läßt sich problemlösendes Denken durch Training fördern? (6) Welche Validität besitzen Studien mit "künstlichen Seelen"? (7) Wird es je eine Theorie des Umgangs mit komplexen Problemen geben?
Links:
Literatur
Szenarien
zurück zur Hauptseite
Zuletzt bearbeitet am 23.01.2004 von JF. |