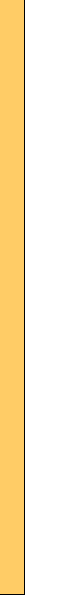
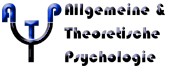
Startseite > Personen > Miriam Spering > Lehre
Seminar "Problemlösen und praktische Anwendungsbereiche"
TerminMontag, 12.15 - 13.45 Uhr, Pädagogische Hochschule, Raum 122
Folien zum download
- Einfaches Problemlösen (Sitzungen vom 12.05. und 19.05.2003)
- Komplexes Problemlösen (Sitzung vom 02.06.2003)
Leitfaden zur Gestaltung eines Referats rtf-file
Veranstaltungsankündigung
Der Fähigkeit, Aufgaben oder Probleme zu lösen, wird in vielen schulischen Bereichen großer Wert beigemessen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen z.B. die Fragen, wie sich die Fähigkeit zum Problemlösen als Merkmal von Expertise entwickelt und wie Problemlösen als Kernkompetenz im Unterricht gefördert werden kann. Problemlösen soll aus allgemeinpsychologischer, entwicklungspsychologischer und differentialpsychologischer Sicht betrachtet werden. Dabei werden neben theoretischen Ansätzen aktuelle Forschungsbefunde diskutiert und vor allem auf ihre praktische Relevanz im schulischen Kontext hin untersucht. Nach einem kurzen historischen Überblick über die Problemlöseforschung und der Betrachtung behavioristischer, gestaltpsychologischer und informationstheoretischer Ansätze soll Problemlösen zunächst aus allgemeinpsychologischer Sicht betrachtet werden. Problemlösestrategien und der Erwerb von Problemlösewissen stehen dabei im Vordergrund. Empirische Ergebnisse der Experten-Novizen-Forschung werden intensiver betrachtet. Entwicklungspsychologische Aspekte des Problemlösens sollen anhand einiger wichtiger Vertreter (Piaget, Vygotsky) und neuerer Ansätze (z.B. Theory of Mind-Forschung) diskutiert werden. Aus differentialpsychologischer Sicht stellt sich in der Problemlöseforschung die Frage nach interindividuellen Unterschieden beim Lösen von Problemen. Exemplarisch sollen Intelligenz, Persönlichkeitsvariablen (z.B. Selbstsicherheit), Emotionen (insbesondere Angst) und Motivation (z.B. Leistungsmotivation) behandelt werden. Dafür werden zunächst theoretische Grundlagen der Intelligenz- und Persönlichkeitsforschung kurz erläutert um dann auf empirische Befunde einzugehen. Schließlich soll anhand praktischer Beispiele auf die lern- und instruktionspsychologischen Konsequenzen der Problemlöseforschung und damit auf Möglichkeiten der Förderung des Problemlösens im Unterricht eingegangen werden. Überlegungen zur Strategiebildung (am Beispiel des Faches Mathematik) werden theoretisch untermauert (z.B. Anchored Instruction-Ansatz). Die Problematik des Transfers von Problemlösewissen auf schulische und außerschulische Bereiche soll kurz angesprochen werden. Abschließend werden Untersuchungsmethoden des Problemlösens (z.B. computersimulierte Szenarien) kurz vorgestellt. Insbesondere soll auf die Methode des lauten Denkens zur Untersuchung von Problemlöseprozessen eingegangen werden.
Ausführlicher Terminplan
12.05.2003 Einführung in die Psychologie des problemlösenden Denkens
- Kurze Einführung in das Thema, Einordnung des Bereichs Problemlösen innerhalb der Psychologie, Eingrenzung und Anwendungskontext
- Abfrage von Erwartungen der Teilnehmenden und Vorstellung
- Begriffsdefinition: „Problem“ / „Problemlösen“
- Organisatorisches und Vergabe von Referaten
19.05.2003 Forschungsansätze zum Problemlösen: Assoziationismus, Gestaltpsychologie und Informationsverarbeitungstheorie
- Anfänge der Problemlöseforschung: der behavioristische Ansatz von Skinner und Thorndike
- Gestaltpsychologischer Ansatz und Einsichtsprobleme
- Ansatz der Informationsverarbeitungstheorie und Dörners Heurismus für analytisches Problemlösen
- Kritische Würdigung und neuere Ansätze (Handlungstheorie, Entscheidungsforschung, Heuristiken)
26.05.2003 Einfaches Problemlösen und berühmte Forschungsparadigmen
- Kryptarithmetische Probleme
- Einsichtsprobleme
- Interpolationsprobleme
- Methoden: Lautes Denken (und Problem der Reaktivität), Analyse von Blickbewegungen
02.06.2003 Komplexes Problemlösen und seine Erhebungsmethoden
- Definition, Merkmale von komplexem Problemlösen und Forschungstradition
- Lohhausen: klassisches Problemlöseszenario
- Befunde zu Lohhausen: Warum machen Menschen Fehler beim Problemlösen?
- Computersimulierte Szenarios als Erhebungsmethoden
09.06.2003 PFINGSTMONTAG
16.06.2003 Gibt es einen Zusammenhang zwischen komplexem Problemlösen und allgemeiner Intelligenz?
- Abstecher in die Intelligenzforschung: Was ist Intelligenz und wie lässt sie sich vom Problemlösen abgrenzen?
- Frühe Befunde zum Zusammenhang von Problemlösen und Intelligenz
- Neuere Erkenntnisse: zur Rolle der Verarbeitungskapazität
23.06.2003 Komplexes Problemlösen und Wissen
- Abstecher: Welche Arten von Wissen gibt es?
- Einfluss von Vorwissen, System- und Steuerungswissen auf Problemlösen
30.06.2003 Problemlösen lernen – Ergebnisse der Expertiseforschung
- Worin unterscheiden sich Experten und Novizen beim Problemlösen?
- Ansätze für die Entwicklung eines Problemlösetrainings
07.07.2003 Problemlösen unterrichten – Trainingsmethoden und Grenzen
- Ansätze aus der Pädagogischen Psychologie
- Transferproblem: was tun gegen träges Wissen?
14.07.2003 Problemlösendes Denken und der Einfluss von Emotion und Motivation
- Sind positive und negative Emotionen förderlich oder hinderlich für Problemlösen?
- Motivieren zum problemlösenden Denken und Handeln
21.07.2003 Problemlösen in der Gruppe: Lob des sozialen Faulenzens?
- Sozialpsychologie des Problemlösens: Effekte der Gruppenstruktur und der Gruppeninteraktion
- Problemlösen und Kommunikation
28.07.2003 Entwicklungspsychologische Aspekte und Wrap-up
Sprechstunde und Kontakt
Email: Miriam.Spering@psychologie.uni-heidelberg.de
Zuletzt bearbeitet am 20.05.2002 von MS. |